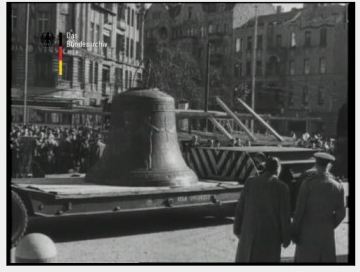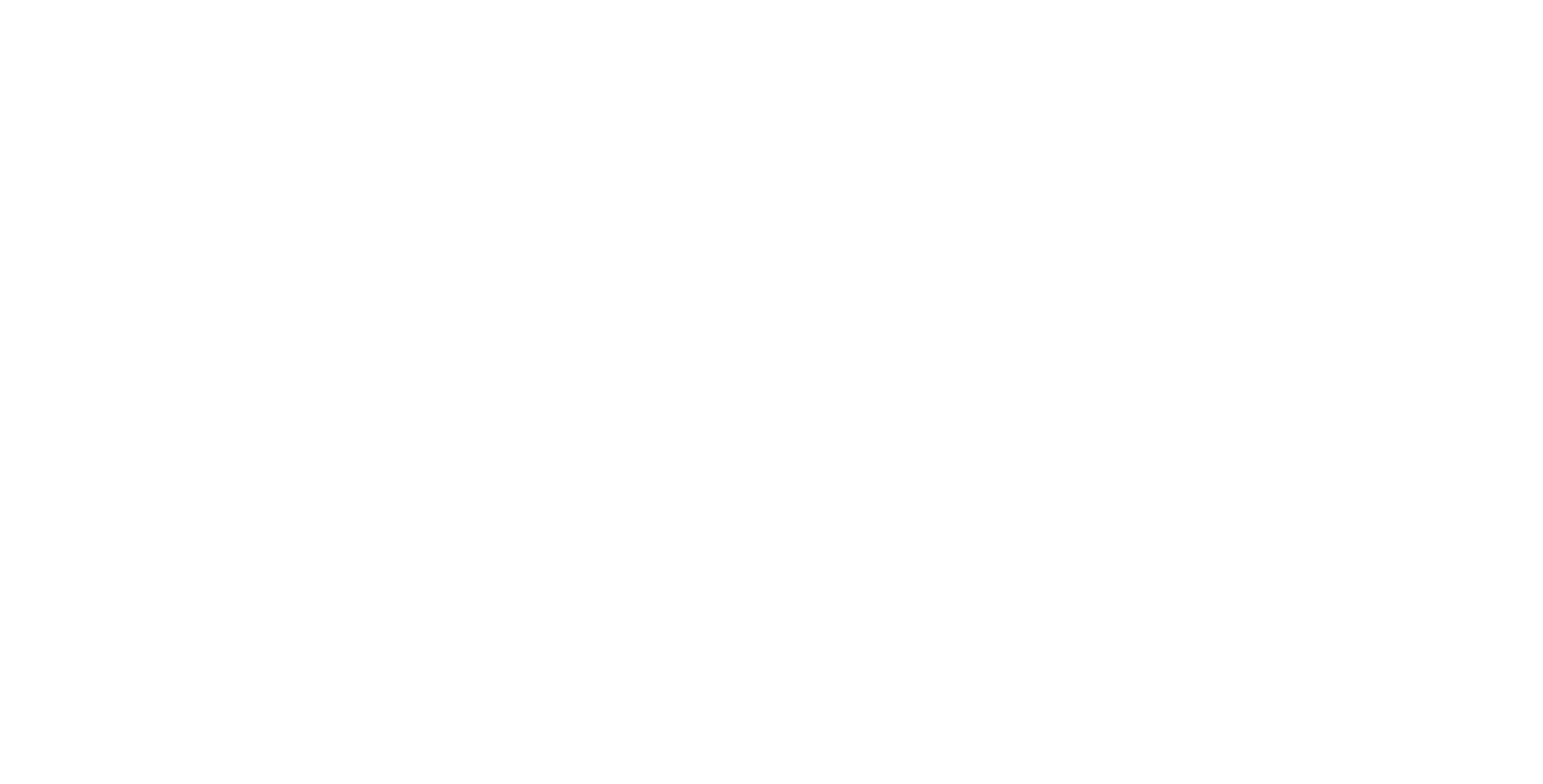Erinnern – Imaginieren – Verstehen. Zur Darstellung von Erinnerung im Spielfilm
Letztlich tun sie alle dasselbe – Rick Blaine mit einer Flasche Gin in seinem Café (Casablanca, 1942), ‚Elle‘ während einer leidenschaftlichen Liebesnacht in Hiroshima (Hiroshima mon amour, 1959) und David ‚Noodles‘ Aaronson auf Fat Moe’s Toilette (Once Upon A Time in America, 1984): sich erinnern. Diese für die meisten Zuschauer*innen selbstverständliche Erkenntnis ist eigentlich höchst erstaunlich. Denn woher wissen wir, dass hier Figuren Einblicke in ihr Gedächtnis geben? Äußerlich unsichtbare, innere Vorgänge wie das Erinnern lassen sich im Unterschied zu den meisten filmischen Motiven und Standardsituationen schließlich nicht direkt abbilden, sondern nur in ästhetische Darstellungen übersetzen.
Hinterfragt man die Selbstverständlichkeit, mit der wir diese und andere Erinnerungssequenzen zu verstehen scheinen, wirft das eine Reihe von Fragen auf, die ich in meinem Promotionsprojekt zu beantworten suche. Grundlegend ist dabei die Annahme, dass Zuschauer*innen mit Filmemacher*innen bestimmte, nur zum Teil explizite Annahmen über Imaginationen und Bewusstseinsprozesse – zu denen auch das autobiografische oder episodische Erinnern gehört – teilen, die die Basis für die Verständigung über derartig schwierig zu objektivierende und konkretisierende, von individuellen Erlebnisqualitäten und Empfindungen begleitete subjektive Phänomene sind. Die audiovisuelle Inszenierung von Erinnerungssequenzen gründet demnach wenigstens zum Teil auf spezifischen, meist impliziten Übereinkünften zwischen Filmschaffenden und Filmsehenden – auf Vorstellungen unter anderem darüber, wie Erinnerungen ‚aussehen‘ und sich ‚anfühlen‘ können, welche Funktionen sie erfüllen und wie sie sich zu verwandten Bewusstseinsprozessen, wie Träumen oder Fantasien, verhalten.
Mein Vortrag versteht sich als Werkstattbericht, der aktuelle Ergebnisse der Arbeit zur Diskussion stellen will.
Maike Sarah Reinerth lehrt und forscht zur Ästhetik, Theorie und Geschichte des Films, kognitiven Medientheorien und Animation Studies.
Ihr Dissertationsprojekt befasst sich mit filmischen Darstellungen von Imaginationen. Sie ist (noch) medienwissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Hamburg, ab April 2017 Stipendiatin des Brandenburgischen Zentrums für Medienwissenschaften (ZeM) und seit 2015 Mutter eines Sohnes.
Aktuelle Publikationen:
- Subjectivity across Media. Interdisciplinary and Transmedial Approaches (2017)
- In Bewegung setzen … Beiträge zur deutschsprachigen Animationsforschung (2017).